1. HMPV-Infektionen: Junge Generationen besonders gefährdet
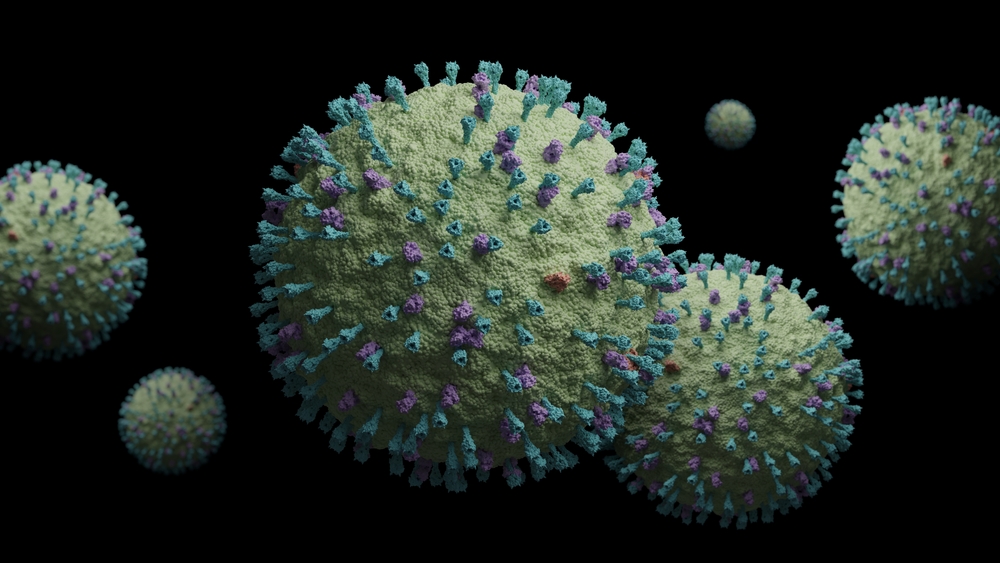
In den Wintermonaten steigt das Risiko für Atemwegserkrankungen deutlich an, was Kliniken weltweit vor Herausforderungen stellt. Auch das Humane Metapneumovirus (HMPV) trägt zu dieser Belastung bei, wie aktuelle Berichte aus China zeigen. Dort kam es vermehrt zu größeren Ausbrüchen, die das Gesundheitssystem an seine Grenzen brachten. Ein wesentlicher Grund dafür ist der sogenannte „Nachholeffekt“: Während der Corona-Pandemie hatten viele Kleinkinder aufgrund strenger Hygieneregeln kaum Kontakt mit Erregern wie HMPV.
Nach der Rückkehr zur Normalität zeigte sich, dass diese Jahrgänge besonders anfällig für Infektionen sind. Ein ähnliches Phänomen wurde bereits beim Respiratorischen Synzytial-Virus (RSV) beobachtet. Experten warnen daher vor möglichen weiteren Ausbrüchen, insbesondere in kalten Jahreszeiten, wenn das Immunsystem ohnehin stärker gefordert ist.
2. Humanes Metapneumovirus: Symptome und Risikogruppen
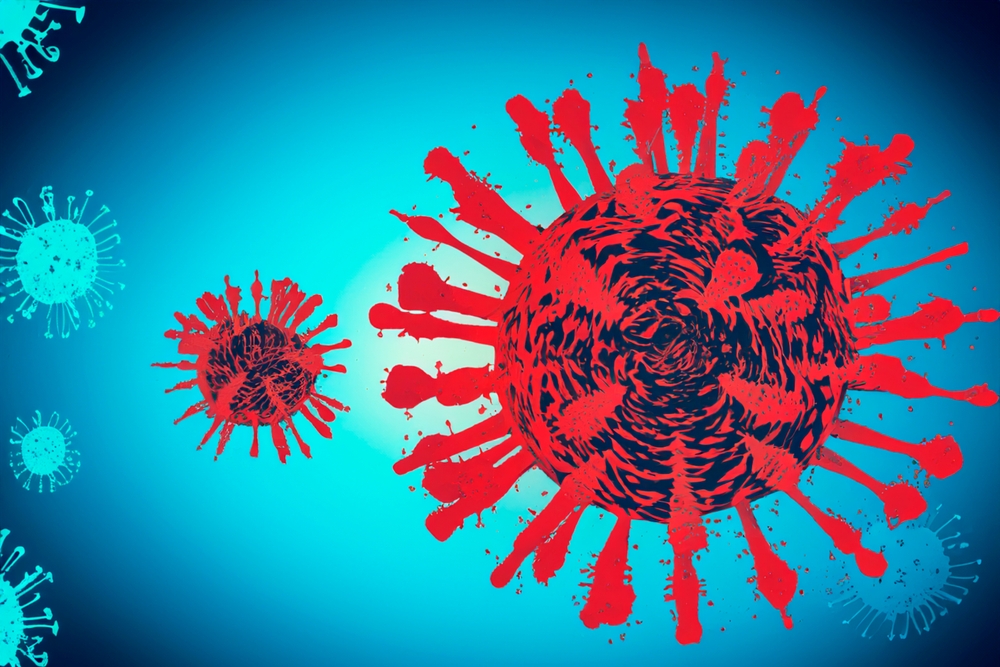
Das Humane Metapneumovirus (HMPV) zeigt ähnliche Symptome wie das Respiratorische Synzytialvirus (RSV) oder die Grippe. Dazu zählen Fieber, Husten, Schnupfen und allgemeine Schwäche. Besonders gefährdet sind Kleinkinder, ältere Menschen und Personen mit geschwächtem Immunsystem. Während die Infektion bei Erwachsenen meist mild verläuft, kann sie bei Kindern schwere Atemwegserkrankungen wie Bronchitis oder Lungenentzündungen verursachen.
HMPV ist nach RSV die zweithäufigste Ursache für Bronchitis bei Kleinkindern. In einigen Regionen Chinas kam es zuletzt zu einem starken Anstieg von HMPV-Infektionen, was zu vielen Krankenhauseinweisungen führte. Experten empfehlen Impfungen gegen RSV und Pneumokokken, um schwere Verläufe zu vermeiden, insbesondere für Kinder und Senioren.
3. HMPV-Infektionen: Diagnostik und Prävention
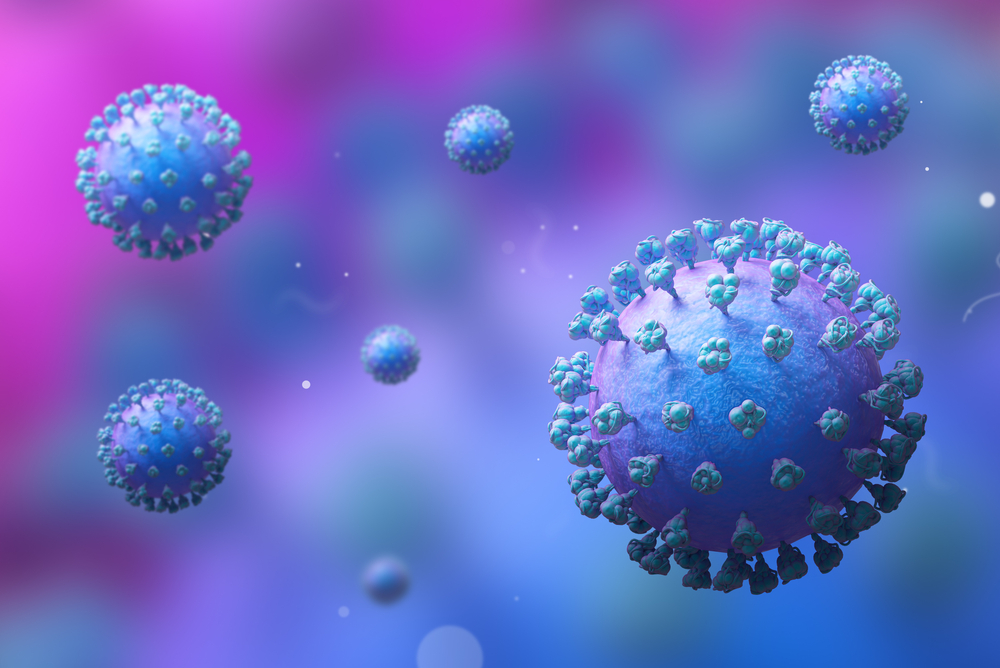
Das Humane Metapneumovirus (HMPV) kann mittlerweile zuverlässig durch moderne PCR-Tests nachgewiesen werden. Im Gegensatz zu Sars-CoV-2, dem Auslöser der Corona-Pandemie, handelt es sich bei HMPV nicht um einen neuartigen Erreger. Laut Robert Koch-Institut (RKI) verfügt ein Großteil der Bevölkerung über eine gewisse Grundimmunität, da viele Menschen bereits im Kindesalter mit dem Virus in Kontakt kamen.
Allerdings bietet eine überstandene Infektion keinen langfristigen Schutz vor einer erneuten Ansteckung – ähnlich wie bei Grippe- oder Coronaviren. Präventive Maßnahmen, wie Hygieneregeln und der Schutz gefährdeter Gruppen, bleiben daher essenziell, um Infektionen einzudämmen und schwere Krankheitsverläufe zu vermeiden.
